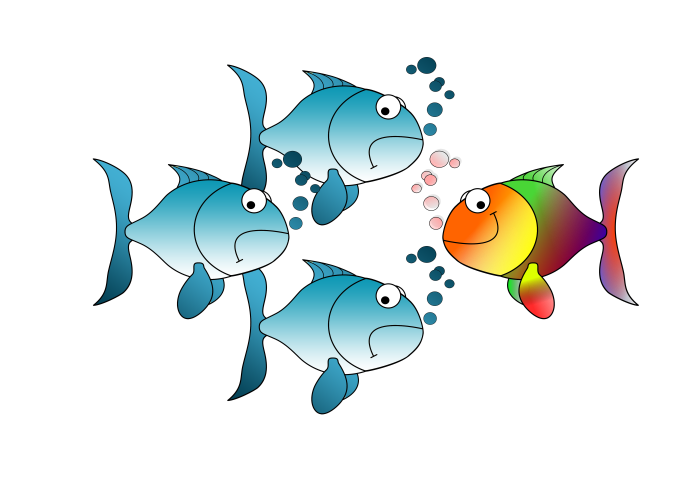
Seit ich in der staatlichen Schule das Fach „ökumenischer Religionsunterricht“ gebe, bin ich bemüht um eine genaue Umschreibung, nein: Definition dieses Fachs.
Diese scheint mir nicht vor dem Hintergrund der paar ex-christlichen Eltern, die sich auflehnen gegen die scheinbar unreflektierte Rede von Gott oder gegen einen vermeintlichen Kreationismus anlässlich der Schöpfungs-Geschichte, notwendig.
Genausowenig geht es mir um eine Selbstrechtfertigung oder gar Selbst-Legitimierung meiner Arbeit.
Nein. Ich versuche diesen Unterricht deshalb so genau wie möglich zu definieren, um seine Bedeutung in der heutigen Schule, Gesellschaft und Lebenswelt hervorzuheben. In vielerlei Hinsicht handelt es sich dabei um die „Herstellung“ eines anderen Orts: eines Raums, in dem über Zustände, Umstände, Verhältnisse und Beziehungen geredet und nachgedacht werden kann, die für jeden Menschen essentiell sind, von der Charakterbildung über die Weltsicht bis hin zu der Lebenseinstellung.
Ich möchte im Folgenden einige Punkte für die Bedeutung eines Religionsunterrichts als besonderen und besonders relevanten Ort im Schulbetrieb anführen.
Ein anderer Ort: Geschichten
In diesem Blog habe ich schon mehrmals über die Bedeutung von Geschichten geschrieben – und werde es sicher noch mehrmals tun (müssen).
Geschichten als Lebensgestalter
Dabei wird mir immer von Neuem klar, dass meine Lieblingsgeschichten jene Geschichten sind, die sofort „ankommen“. Jene Geschichten also, zu denen die Schüler*innen unmittelbar und unvermittelt den Zugang finden, die sie sofort verstehen. Das sind meist auch jene Geschichten, die sofort „Eingang“ in ihre Gedankenwelt finden. Und sich dort im besten mit ihren Lebensumständen und ihrer Sicht aufs Leben verbinden. Jene Geschichten, die fast natürlich zu einem Bestandteil ihres instinktiven Argumentariums werden für jene Momente, in denen sie in einer Krise, im Zweifel oder sonstwie im Lebenssinn bedroht sind.
Geschichten gegen die Geschichtenarmut
Gleichzeitig weiss ich um die Geschichtenarmut unserer Welt. Diese Armut hat zwei Gesichter:
1. Fehlende Geschichten in der Familie: Viele meiner Schüler*innen wachsen in Familien auf, in denen das Erzählen (sei es am Bett oder am Mittags- oder Abendtisch) keine Bedeutung hat. Dass ein Erwachsener wie der Religionslehrer sog erne und enthusiastisch Geschichten erzählt, wirkt sich positiv aus: Die Schüler*innen erkennen, wie wichtig das Erzählen von Geschichten – auch aus dem eigenen Erleben – für die Selbstwerdung ist, für die Selbstwertung. Sie erkennen auch den gemeinschafts- und zusammenhaltsfördernden Wert des Geschichtenerzählens. Viele meiner Schüler*innen sind regelrecht „geschichtenhungrig“, kommen in meinen Unterricht, weil hier das Erzählen, das Imaginieren einen wirklichen (Stellen-) Wert hat.
2. Eigenes Erleben ist keiner Geschichte wert: In anderen Kulturen mag das Erzählen zur DNA eines erfüllten menschlichen Lebens gehören. Nicht so in einem mitteleuropäischen, zur Nüchternheit und Selbstentwertung neigenden Land wie der Schweiz: Das eigene Leben, die eigene Lebenserfahrung wird hier nicht als „erzählenswert“ verstanden. Und wer seine Erfahrung nicht erzählenswert findet, wird nicht erzählen lernen. Doch nur über das Erzählen – so meine Einsicht – wird Verarbeitung, Vertiefung und Verständigung möglich. (Als Beispiel kann folgende Überlegung dienen: Da wir keine Erzählungen von Flüchtlingen hören, fällt es uns schwer, ihre Lebenserfahrung integrativ in unsere eigene Weltsicht einzubinden.)
Manchmal wünschte ich mir fast, wir würden uns weg von einer visuellen hin zu einer oralen Gesellschaft entwickeln. Wünschte ich mir, Erzählen würde ein anerkanntes Schulfach.
Ein anderer Ort: Imaginieren
Auch das Imaginieren und die Wertschätzung für die Einbildungs- und Vorstellungskraft hat in unserer Gesellschaft kaum eine Bedeutung. Dabei ist es gerade für die Selbstwerdung und Selbstwertung unumgänglich, sich mit der Imagination (der eigenen und der anderer) auseinanderzusetzen.
Im Religionsunterricht findet sich immer wieder der Platz, die Vorstellungskraft der Schüler*innen einzusetzen. Selbst dann, wenn ihre Vorstellungskraft bereits von kapitalistisch-hollywoodianischen Vorbildern besetzt ist, kann es gelingen, dass die Schüler*innen eine „andere Weltsicht“, eine „andere Lebenshaltung“ imaginieren.
Denn wer nicht gelernt hat, sich ein „anderes Leben“, eine „andere Welt“ vorzustellen, wird sein Leben in einem Gefängnis von unreflektierten, nachgesprochenen oder unverdauten Ansichten fristen.
Ein anderer Ort: Werte und Urteile prüfen
Betrachtet man die Auswirkungen von Geschichten und die imaginative Ermächtigung auf Schüler*innen genauer, wird man feststellen, dass sie dazu befähigt werden, Werte und Urteile zu hinterfragen und überprüfen.
Wer dies gelernt hat – die Kompetenz, hinter Werte und Urteile zu blicken -, wird im Leben unvoreingenommener und empathischer mit anderen Menschen in Beziehung treten.
Ein anderer Ort: Erfahrungen machen
Ein Grossteil des schulischen Unterrichts dreht sich um den Erwerb von Kompetenzen, die mit Wissen und Wissensgewinnung zu tun haben: mathematische Lösungen oder Lösungswege finden, thematisches Wissen erarbeiten, Texte verstehen lernen, etc.
Dabei bleibt oft auf der Strecke, dass dabei nur die „Oberfläche“ gestreift wird. So sind Informationen oder Wissen über religiöse Feste, Bräuche oder Glaubensgrundsätze gut und recht. Doch das Verstehen ihrer Wurzeln, Gründe und Formen kann dieser sachorientierte Ansatz nicht vermitteln.
Erst die Erfahrung von Lebensumständen oder Lebensgeschichten jedoch wird jenes Wissen vermitteln, das unser Schüler*innen zu reiferen, nachdenklicheren Menschen formen kann. Was meine ich mit Erfahrung(en)?
Im Rahmen des übergreifenden Themas der „Gerechtigkeit“ habe ich die Schüler*innen zum Beispiel in ein Planspiel geschickt, in dessen Rahmen sie die Rolle verschiedener gesellschaftlicher Positionen (arm, reich, arbeitslos, angestellt, etc.) erleben: in einer kontrollierten, kurzfristigen und spielerischen Installation in der Religionsstunde. Dabei haben die Schüler*innen spielerisch, aber am eigenen Körper und Empfinden erfahren, was es heisst, in einer anderen gesellschaftlichen oder persönlichen Lage zu sein.
Diese Erfahrung hat manche Schüler*in sehr nachdenklich und weitaus empathischer gemacht für das Schicksal anderer Menschen.
Ziel: eine andere Welt ermöglichen
Natürlich könnte ich noch viele andere Merkmale aufzählen, die den Religionsunterricht, wie ich ihn verstehe, kennzeichnen und als „anderen Ort“ charakterisieren.
Letztlich aber messe ich mein Unterrichten daran, ob und inwiefern es dazu führen kann, den werdenden Menschen andere Wege, andere Welten aufzuzeigen. Dies natürlich immer vor dem Hintergrund der Erzählungen von Menschen in Beziehung zueinander und zu Gott – dem grossen Fragezeichen und dem grossen Anderen.